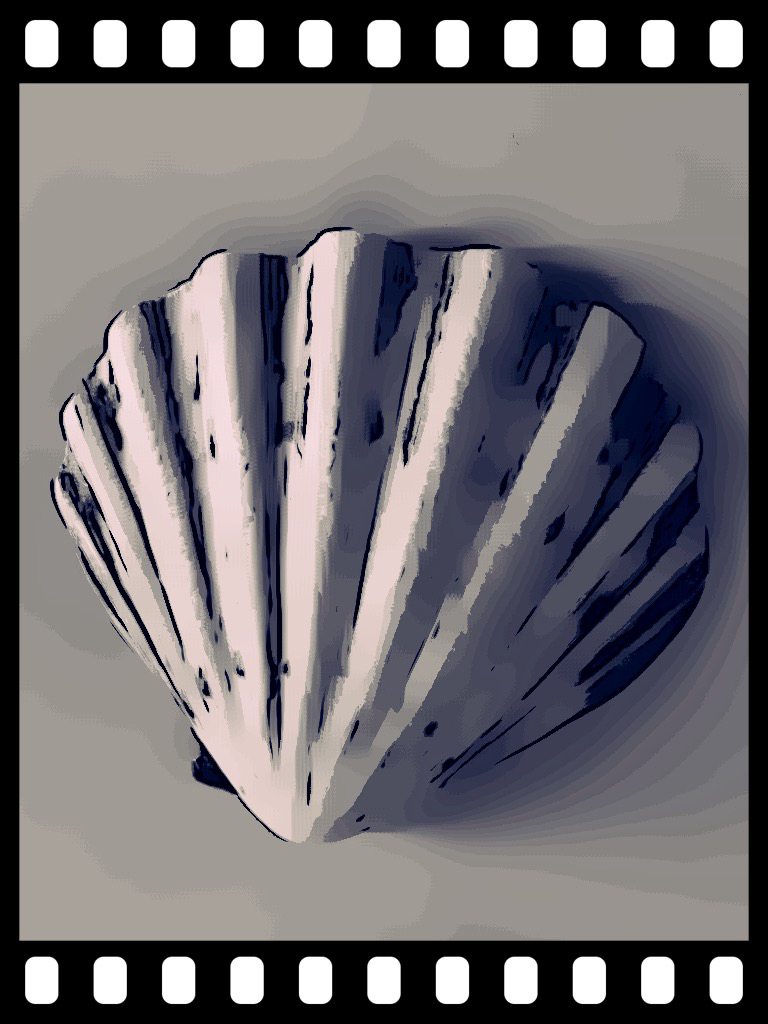Mutter Teresa ist 86 geworden: Der Versuchung, sich im Lob zu sonnen, hat sie widerstanden
Die katholische Ordensgründerin Mutter Teresa hat am Dienstag dieser Woche im indischen Kalkutta ihren 86. Geburtstag gefeiert. Am vergangenen Wochenende ist sie ernsthaft krank geworden. Ihr Zustand hatte sich aber an ihrem Festtag etwas gebessert. Sie hat sich ihr Leben lang selbst sehr gefordert. „Lasse nie zu, daß du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist.“ Mit diesem Anspruch ist sie zu dem Armen und Kranken in die Elendsviertel von Kalkutta gegangen.
Siebzehn Jahre zuvor, im Jahr 1929, war die Albanerin aus Irland nach Indien gekommen. Sie gehörte dem irischen Orden der Loreto-Schwestern an. In Kalkutta unterrichtete Mutter Teresa an einer Schule ihres Ordens wohlhabende Mädchen in Geographie, Geschichte und Religion. 1946 war sie gerade zwei Jahre lang Schuldirektorin, als sie sich berufen fühlte, in die Slums zu gehen.
Die Menschen, die die Ordensfrau besuchte, waren verzweifelt. Als Hindus glaubten sie, ihr Schicksal sei unabwendbar. Aus diesem Grund brauchten besonders die Menschen aus schwierigen Verhältnissen diese Begegnung, die sie wieder aufrichtete. Mutter Teresa war die erste, die nicht auf die gesellschaftliche Stellung, sondern auf die Not dieser Armen achtete. Ihr folgten immer mehr Helferinnen. Der örtliche Bischof und der Vatikan genehmigten ihr 1948, außerhalb des Klosters in den Elendsvierteln zu arbeiten. 1949 konnte sie einen eigenen Orden gründen: Die Missionarinnen der Nächstenliebe.
Sie verbreiten das Ideal der Nächstenliebe, indem sie es an Hungernden, Kranken, Säuglingen und Sterbenden praktizieren. Nach dem Vorbild Mutter Teresas führen sie alle ein bescheidenes bis karges Lebens. Ihr Frühstück ist die einzige Mahlzeit am Tag. Sie tragen den weißen Sari, wie die Armen in Bengalen. Sie geloben nicht nur Armut, Keuschheit und Gehorsam, sondern auch den „Dienst an den Ärmsten der Armen von ganzem Herzen ohne Gegenleistung“.
Inzwischen dienen dreitausend Missionarinnen und fünfhundert Missionare in fünf Kontinenten den Bedürftigen. Waisen- und Sterbehäuser, Tuberkulose- und Entbindungskliniken, Schulen und Häuser für ledige Mütter zeugen auf der ganzen Welt von der Nächstenliebe der Ordensschwestern und -brüder. Viele der Missionarinnen sind Töchter wohlsituierter Eltern, wie Mutter Teresas ehemalige Schülerinnen. Auch sie selbst kommt als Tochter eines Bauunternehmers aus einer begüterten Familie. Jetzt besitzt sie nichts weiter als drei weiße Sari und ein kleines Ansteckkreuz.
Sie hat wegen ihrer aufopfernden Arbeit viele Ehrungen in ihrem Leben erhalten: Den Friedenspreis des Papstes und den der Kulturorganisation der Vereinten Nationen, UNESCO, viele Ehrendoktortitel und Ehrenbürgerschaften. Zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die Ordensgründerin sollte ein teures Festbankett gegeben werden. Sie bat, auf die Feier zu verzichten und die Unkosten ihrer Arbeit zukommen zu lassen. Fünfzehntausend Menschen konnten durch dieses Geschenk etwas Warmes essen. Der Versuchung, sich feierlich im Lob zu sonnen, hatte Mutter Teresa mit dieser Geste widerstanden. Sie will nicht, daß die Welt sie feiert.

Die Verfasserin begegnete der Preisträgerin 1989 beim Internationalen Familienkongreß. Sie traf auf eine kleine Frau, die von nervösen Sicherheitsbeamten und hektischen Fotoreportern umringt, in ihren Gedanken ruhte. Sie blickte nicht zur Seite, nur geradeaus auf ihren Weg zu dem Saal, in dem sie zu den Kongreßteilnehmern reden sollte. Ihre Ruhe übertrug sich auf die über dreitausend Zuhörer, die während ihrer Ansprache innehielten.
Ungeachtet Mutter Teresas selbstlosen Engagements verbreitete der britische Fernsehsender Channel 4 vor zwei Jahren Absurdes in einer Dokumentation: Anstatt bei den Bedürftigen zu weilen, lasse sie sich lieber mit den Mächtigen sehen. In den Fernsehbeitrag wurde ihr vorgeworfen, bei Begegnungen mit kommunistischen Diktatoren über Menschenrechtsverletzungen geschwiegen zu haben.
Die Friedensnobelpreisträgerin ist aber eine eifrige Verfechterin des fundamentalsten Menschenrechts: des Rechts auf Leben. Dafür ist sie ganz besonders in kommunistischen Ländern eingetreten. Bei ihrem DDR-Besuch im März 1988 feierte sie in der St.-Hedwigs-Kathedrale einen Gottesdienst unter dem Motto „Ja zum ungeborenen Leben“. Mutig sprach sie dort das Thema Abtreibung an. In der DDR durfte jedes ungeborene Kind während der ersten drei Monate im Mutterleib getötet werden. Mutter Teresa sagte damals zu den Gottesdienstteilnehmern: „Ich habe euch meine Schwestern gegeben, und ich hoffe, daß ihr zusammen mit ihnen etwas Schönes für Gott tun könnt: damit in dieser schönen Stadt Berlin kein Mann, keine Frau, kein Kind, kein ungeborenes Kind sich ungeliebt und nicht angenommen fühlt.“ Die Ordensfrau plädierte dafür, ein unerwünschtes Kind zur Adoption freizugeben, anstatt es abtreiben zu lassen. Sie läßt den Worten auch Taten folgen: Sie und ihre Helferinnen sammeln ausgesetzte Säuglinge von den Straßen auf und unterhalten Heime für ledige Mütter.
Trotz ihres unmißverständlichen Standpunktes hat es Mutter Teresa geschafft, in Ländern wie Kuba und Vietnam arbeiten zu dürfen. Nur China hat den Missionarinnen der Nächstenliebe ihre Liebestätigkeit verboten. Die Generaloberin will erreichen, daß dieses Verbot aufgehoben wird. Gerade dort, wo aufgrund der Ein-Kind-Politik Ungeborene und Säuglinge getötet werden, kann sie mit tätiger Nächstenliebe ein Vorbild sein. Der atheistische Philosoph Friedrich Nietzsche äußerte einmal: „Wenn die Christen doch erlöster aussähen…“ Die Christin Mutter Teresa sieht „erlöster“ aus.
Der Artikel ist am 31. August 1996, ein Jahr vor Mutter Teresas Tod in „Deutsche Tagespost“ erschienen.